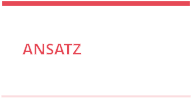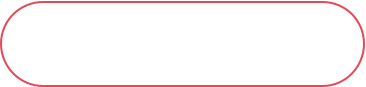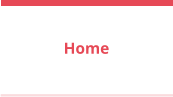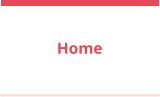Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit, das deren wesentlichen
Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein
strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist
insbesondere
im Kontext sozialer Systeme anzustreben.
Kurzbeschreibung der Inhalte
Emergente Strategien
Strategien basieren nicht notwendigerweise auf einer
ausführlichen Analyse. Auch werden nicht alle
Strategien ausdrücklich geplant. Vielmehr können sie
sich auch als Muster in einem Strom von
Entscheidungen und Handlungen des Unternehmens
"ergeben".
Solche emergenten Konzepte entspringen zwar keiner
formalen strategischen Analyse und keiner expliziten
Formulierung - dennoch entsteht faktisch eine
Strategie. Einzelmaßnahmen formieren sich in diesem
Fall zumindest rückblickend zu einem bestimmten
Muster. Retrospektiv ist unter Umständen sogar eine
vergleichsweise einheitliche, konsistente Strategie zu
erkennen.
Die Gründe für eine derartige Emergenz sind äußerst
vielschichtig. Zunächst lassen sich die generellen
Grenzen der Planbarkeit dafür verantwortlich machen,
die zum Beispiel aus der Komplexität und Dynamik
der Umwelt, aus dem Charakter der kollektiven
politischen Entscheidungsprozesse in Unternehmen
und aus beschränkten Problemlösungskapazitäten
von Individuen resultieren.

Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Entscheidertypen
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:
Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen
Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege
zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und
alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn
Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede
Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur
Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der
Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische
Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:
1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und
3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee
Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.
Alternative Wirtschafts- und
Gesellschaftskonzepte
Dieses Zukunftsdossier beschreibt verschiedene Wirtschafts- und
Gesellschafts-Konzepte, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: die
Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu erhöhen und
dabei gleichzeitig innerhalb der ökologischen Tragfähigkeit des Planeten
zu bleiben. Die folgenden Themen sind Alternativen, die auf Wachstum
mit neuen Attributen setzen, die Wachstum als Problem thematisieren
und die das Wohlbefinden der Menschen ins Zentrum rücken.

Nachhaltiges Leitkonzept (Wirtschaften)
Das in der Forstwirtschaft seit Jahrhunderten angewandte Prinzip der Nachhaltigkeit ist unter dem Aspekt der Ökonomie als Art des Wirtschaftens zu bezeichnen, bei welcher derzeitige Bedürfnisse befriedigt werden, ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen (Sustainable Development). Kennzeichnung durch langfristig orientiertes Denken und Handeln, um ein Fließgleichgewicht der natürlichen Ressourcen zu erreichen. Neben der Ökonomie werden heute auch Ökologie und Soziales einbezogen.
Normatives Leitkonzept
Als normatives Leitkonzept werden häufig internationale Standards verwendet, Zu den bekanntesten derartigen Normen zählen die ISO 9001 für Qualitätsmanagement, die ISO 14001 für Umweltmanagement, die ISO 31000 für Risikomanagement und die ISO 26000 für die Gesellschaftliche Verantwortung. Es handelt sich hierbei um weltweit anerkannte Normen, die von Unternehmen angewendet werden, um verifizierbare und transparente Abläufe (Verfahren, Prozesse, etc.) zu schaffen und die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen.
Leitbild mit Vision, Mission
Ein Leitbild ist die intern vereinbarte Selbstbeschreibung der übergeordneten Ziele, als Vision (langfristiges Entwicklungsziel), als Mission (Daseins-Zweck, auch Nutzen) und als Werte (Grundsätze des Vorgehens und des Verhaltens) eines Unternehmens. Weder wirtschaftliche noch technologische, anwendungs- oder bedarfsorientierte Sichten vermögen allein die Richtung der Entwicklung zu weisen. Vielmehr sollten neben technischen und wirtschaftliche Entwicklungen (des Wandels) soziale und gesellschaftliche Werte in geeigneter Weise in ein gemeinsames Leitbild integriert werden.
Leitidee als Sinnfindung
Die Leitidee drückt den Sinn des Unternehmens aus: Warum sind wir hier? Was wollen wir erreichen? Welchen Nutzen stellen wir unseren Kunden zur Verfügung? Die Leitidee erwächst aus Weltbildern (untere Werte-Ebene) und Leitkonzepten (mittlere Werte-Ebenen). Eine Leitidee verbindet Interessen-Gruppen, fördert Partnerschaften, prägt die Identität eines Unternehmens und die seiner Mitarbeiter, motiviert alle Beteiligten und spricht auch deren emotionale Seite an, verstärkt die eigene und gemeinsame Identität, fördert den Konsens und die Zufriedenheit, hat vor allem qualitative Charakter und ist einfach zu vermitteln.
Konzeptionelle Grundsätze
Zielhorizont der Unternehmensgemeinschaft ist Selbstorganisation (in Richtung Autonomie), Vertrauen (auch Solidarität) und Kompetenz; es steht das moderne Menschenbild im Vordergrund. Als Leitbild zur individuellen Entwicklung gilt: Durch Eigenaktivität soll jedem die Möglichkeit gegeben werden sich selbstständig weiterentwickeln zu können. Dies schließt eine eigene Meinung zu bilden und sich selbstständig zu entscheiden ein; dabei ist auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Jeder ist dafür mitverantwortlich, ein entsprechend anregendes Umfeld und eine verlässliche Beziehung zu Anderen zu bieten. Als Konzeptionelle Grundsätze gelten sechzehn Maximen.
Infostrategiekonzept OODA - Loop
OODA-Loop ist ein Informationsstrategiekonzept aus dem militärischen Bereich. Es definiert eine zirkuläre Entscheidungsschleife, die aufgrund eines neuen Ereignisses immer wieder durchlaufen wird. Die Theorie versucht somit eine Verhaltensweise, die Reaktion eines Individuums oder einer ganzen Organisation in einer (fremden) Umgebung gegenüber einem Ereignis abstrakt darzustellen. OODA bedeutet im Einzelnen: Observe - beobachten, Orient - orientieren, Decide - entscheiden und Act - handeln.
Visionäre Strategien und Trends
Durch Wissen (Wissensmanagement) und Kreativität können neue Konzepte und zukunftsfähige Innovationen entstehen. Best Practices , als Methode, Erfahrungswissen umzusetzen, funktionieren nur bei einfachen Problemstellungen. Komplexe oder chaotische Sachlagen benötigen einen anderen Umgang: Erst ausprobieren, dann wahrnehmen und erst am Ende reagieren. Neben Social Media, intellektuellem Kapital und Wandlungsfähigkeit spielt in diesem Kontext die IT eine wichtige, neue Rolle.
Entscheidungsfindung
Akteure (Führungskräfte und Mitarbeiter) müssen akzeptable
Entscheidungen treffen, auch bei Konflikten; Widersprüche
sind auf eine „höhere Ebene“ zu bringen. Die drei Arten von
Entscheidungen sind:
1. Logische Entscheidung (Experten fragen).
2. Taktische Entscheidung (schnell entscheiden).
3. Strategische Entscheidung (dialektischer Prozess).
Fast alle Entscheidungen (99%) sind Gewohnheiten (Schnelles
Denken nach D. Kanemann). Sollte man rational oder intuitiv
entscheiden? Es gibt rein rationale Abwägungen, aber keine
rein rationalen Entscheidungen, wegen der „begrenzten
Rationalität“ der Akteure. Entscheidungsgrundlage ist die
„subjektive Wahrheit“ des Akteurs, die intuitive
Entscheidungen zulässt.
Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen
Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)
und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.
Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).
Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird
bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als
eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt
angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies
geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form
eines Paradigmenwechsels.
Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch
Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem
ganzheitlichen Konzept.
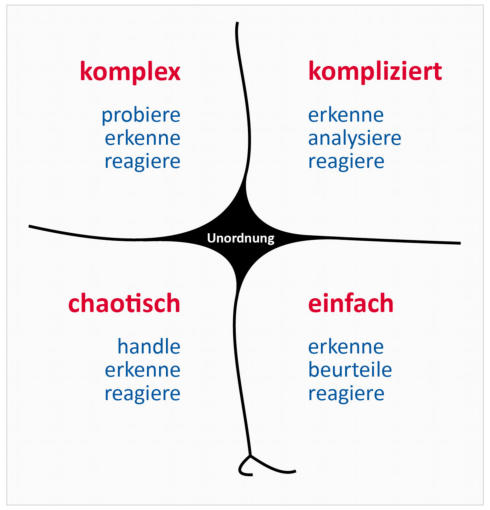
David John Snowden ist Experte für implizites Wissen und arbeitet als Dozent, Berater und
Wissenschaftler.
Im Rahmen des Cynefin-Frameworks werden Probleme nach ihrer Art klassifiziert und ein
entsprechender Umgang mit ihnen vorgeschlagen:
•
Einfache Probleme basieren auf klaren Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Wenn eine
bestimmte Ausgangssituation beobachtet wird, kann auf Grund von Erfahrungen (“Best
Practices”) eine angemessene Reaktion stattfinden.
•
Bei komplizierten Problemen müssen Ausgangssituationen intensiver analysiert werden,
bevor darauf reagiert werden kann. Dabei gibt es häufig verschiedene Arten zu reagieren, die
ähnlich gut sind (“Good Practices”).
•
Komplexe Fragestellungen werden dadurch charakterisiert, dass aufgrund einer
Ausgangssituation die Wirkung bestimmter Maßnahmen nicht vorhersehbar ist. Somit wird
als Handlungsempfehlung eine experimentelle Herangehensweise (“ausprobieren,
wahrnehmen, reagieren”) vorgeschlagen (“Emergent Practices”).
•
Chaotische Problemstellungen sind so geartet, dass gar keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen
aufgestellt werden können. Somit ist die Handlungsempfehlung agieren, wahrnehmen,
reagieren mit dem Ziel, das System zu stabilisieren. Dabei entstehen Erfahrungen im Sinne
einer “Novel Practice”.
“Novel Practice”
“Emergent Practices“
“Good Practices”
“Best Practices”
Aus: http://cognitive-edge.com/

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept

Leitkonzepte
(als grundlegende Werte)
Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker auf einer
grundlegenden Werte-Ebene. Das ausformulierte Leitkonzept
hat die Aufgabe als eine Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die
Entwicklung von Methoden und die Ausgestaltung von
Leitbildern auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die
allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere Vorstellungen zur
Umsetzung. Leitkonzepten liegen oft “Weltbilder” zu Grunde.
Auf diese “Weltbildebene” ist z. B. auch die Vorstellung
anzusiedeln, dass man “von der Natur lernen” kann.
Leitkonzept (Ganzheitliches Management)



Nach Ulrich ist ein (strategisches)
Konzept ein abstraktes
Gestaltungsmodell einer zu
erschaffenden Wirklichkeit, das
deren wesentlichen Komponenten
und Beziehungs- und
Wirkungsgefüge abbildet, aber
Möglichkeiten des konkreten
Planens (der Projekte) offen lässt.
Ein strategisches Konzept ist
langfristig angelegt und sollte auch
das Leitkonzept und das spezifische
Leitbild des Unternehmens
beinhalten; dies ist insbesondere
im
Kontext sozialer Systeme
anzustreben.
Kurzbeschreibung der Inhalte
Das Cynefin Frameworks -
eine visionäre Strategie
Qui i
Emergente Strategien
Strategien basieren nicht notwendigerweise
auf einer ausführlichen Analyse. Auch
werden nicht alle Strategien ausdrücklich
geplant. Vielmehr können sie sich auch als
Muster in einem Strom von Entscheidungen
und Handlungen des Unternehmens
"ergeben".
Solche emergenten Konzepte entspringen
zwar keiner formalen strategischen Analyse
und keiner expliziten Formulierung -
dennoch entsteht faktisch eine Strategie.
Einzelmaßnahmen formieren sich in diesem
Fall zumindest rückblickend zu einem
bestimmten Muster. Retrospektiv ist unter
Umständen sogar eine vergleichsweise
einheitliche, konsistente Strategie zu
erkennen.
Die Gründe für eine derartige Emergenz
sind äußerst vielschichtig. Zunächst lassen
sich die generellen Grenzen der Planbarkeit
dafür verantwortlich machen, die zum
Beispiel aus der Komplexität und Dynamik
der Umwelt, aus dem Charakter der
kollektiven politischen
Entscheidungsprozesse in Unternehmen
und aus beschränkten
Problemlösungskapazitäten von Individuen
resultieren.
Nachhaltiges Leitkonzept
(Wirtschaften)
Das in der Forstwirtschaft seit Jahrhunderten angewandte Prinzip der Nachhaltigkeit ist unter dem Aspekt der Ökonomie als Art des Wirtschaftens zu bezeichnen, bei welcher derzeitige Bedürfnisse befriedigt werden, ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen (Sustainable Development). Kennzeichnung durch langfristig orientiertes Denken und Handeln, um ein Fließgleichgewicht der natürlichen Ressourcen zu erreichen. Neben der Ökonomie werden heute auch Ökologie und Soziales einbezogen.Normatives Leitkonzept
Als normatives Leitkonzept werden häufig internationale Standards verwendet, Zu den bekanntesten derartigen Normen zählen die ISO 9001 für Qualitätsmanagement, die ISO 14001 für Umweltmanagement, die ISO 31000 für Risikomanagement und die ISO 26000 für die Gesellschaftliche Verantwortung. Es handelt sich hierbei um weltweit anerkannte Normen, die von Unternehmen angewendet werden, um verifizierbare und transparente Abläufe (Verfahren, Prozesse, etc.) zu schaffen und die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen.Leitkonzepte
(als grundlegende Werte)
Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker
auf einer grundlegenden Werte-Ebene. Das
ausformulierte Leitkonzept hat die Aufgabe als eine
Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die Entwicklung von
Methoden und die Ausgestaltung von Leitbildern
auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die
allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere
Vorstellungen zur Umsetzung. Leitkonzepten liegen
oft “Weltbilder” zu Grunde. Auf diese “Weltbildebene”
ist z. B. auch die Vorstellung anzusiedeln, dass man
“von der Natur lernen” kann.
Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.
Leitbild mit Vision, Mission
Ein Leitbild ist die intern vereinbarte Selbstbeschreibung der übergeordneten Ziele, als Vision (langfristiges Entwicklungsziel), als Mission (Daseins-Zweck, auch Nutzen) und als Werte (Grundsätze des Vorgehens und des Verhaltens) eines Unternehmens. Weder wirtschaftliche noch technologische, anwendungs- oder bedarfsorientierte Sichten vermögen allein die Richtung der Entwicklung zu weisen. Vielmehr sollten neben technischen und wirtschaftliche Entwicklungen (des Wandels) soziale und gesellschaftliche Werte in geeigneter Weise in ein gemeinsames Leitbild integriert werden.Leitidee als Sinnfindung
Die Leitidee drückt den Sinn des Unternehmens aus: Warum sind wir hier? Was wollen wir erreichen? Welchen Nutzen stellen wir unseren Kunden zur Verfügung? Die Leitidee erwächst aus Weltbildern (untere Werte-Ebene) und Leitkonzepten (mittlere Werte-Ebenen). Eine Leitidee verbindet Interessen- Gruppen, fördert Partnerschaften, prägt die Identität eines Unternehmens und die seiner Mitarbeiter, motiviert alle Beteiligten und spricht auch deren emotionale Seite an, verstärkt die eigene und gemeinsame Identität, fördert den Konsens und die Zufriedenheit, hat vor allem qualitative Charakter und ist einfach zu vermitteln.Empowerment als Leitidee
Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.Konzeptionelle Grundsätze
Zielhorizont der Unternehmensgemeinschaft ist Selbstorganisation (in Richtung Autonomie), Vertrauen (auch Solidarität) und Kompetenz; es steht das moderne Menschenbild im Vordergrund. Als Leitbild zur individuellen Entwicklung gilt: Durch Eigenaktivität soll jedem die Möglichkeit gegeben werden sich selbstständig weiterentwickeln zu können. Dies schließt eine eigene Meinung zu bilden und sich selbstständig zu entscheiden ein; dabei ist auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Jeder ist dafür mitverantwortlich, ein entsprechend anregendes Umfeld und eine verlässliche Beziehung zu Anderen zu bieten. Als Konzeptionelle Grundsätze gelten sechzehn Maximen.
Entscheidungsfindung
Akteure (Führungskräfte und Mitarbeiter) müssen
akzeptable Entscheidungen treffen, auch bei
Konflikten; Widersprüche sind auf eine „höhere
Ebene“ zu bringen. Die drei Arten von
Entscheidungen sind:
1. Logische Entscheidung (Experten fragen).
2. Taktische Entscheidung (schnell entscheiden).
3. Strategische Entscheidung (dialektischer
Prozess).
Fast alle Entscheidungen (99%) sind Gewohnheiten
(Schnelles Denken nach D. Kanemann). Sollte man
rational oder intuitiv entscheiden? Es gibt rein
rationale Abwägungen, aber keine rein rationalen
Entscheidungen, wegen der „begrenzten
Rationalität“ der Akteure. Entscheidungsgrundlage
ist die „subjektive Wahrheit“ des Akteurs, die
intuitive Entscheidungen zulässt.
Entscheidertypen
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark
verändert: Sie ist schneller und unübersichtlicher
geworden. Müssen Entscheidungen getroffen
werden, bleibt der Führungsriege zuweilen nur
wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und alle
nötigen Informationen zu sammeln. Und auch,
wenn Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht
jede Führungskraft hat immer den Mut und die
Fähigkeit zur Entscheidung. Entscheidungen sind
häufig von der Persönlichkeit, d.h. vom
Entscheidertyp abhängig; klassische
Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:
1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher)
und 3. Visionär (Entdecker).
Alternative Wirtschafts- und
Gesellschaftskonzepte
Dieses Zukunftsdossier beschreibt verschiedene
Wirtschafts- und Gesellschafts-Konzepte, die alle ein
gemeinsames Ziel verfolgen: die Lebensqualität und
das Wohlbefinden der Menschen zu erhöhen und
dabei gleichzeitig innerhalb der ökologischen
Tragfähigkeit des Planeten zu bleiben. Die folgenden
Themen sind Alternativen, die auf Wachstum
mit neuen Attributen setzen, die Wachstum als
Problem thematisieren
und die das Wohlbefinden der Menschen ins
Zentrum rücken.
Infostrategiekonzept OODA - Loop
OODA-Loop ist ein Informationsstrategiekonzept aus dem militärischen Bereich. Es definiert eine zirkuläre Entscheidungsschleife, die aufgrund eines neuen Ereignisses immer wieder durchlaufen wird. Die Theorie versucht somit eine Verhaltensweise, die Reaktion eines Individuums oder einer ganzen Organisation in einer (fremden) Umgebung gegenüber einem Ereignis abstrakt darzustellen. OODA bedeutet im Einzelnen: Observe - beobachten, Orient - orientieren, Decide - entscheiden und Act - handeln.Visionäre Strategien und Trends
Durch Wissen (Wissensmanagement) und Kreativität können neue Konzepte und zukunftsfähige Innovationen entstehen. Best Practices , als Methode, Erfahrungswissen umzusetzen, funktionieren nur bei einfachen Problemstellungen. Komplexe oder chaotische Sachlagen benötigen einen anderen Umgang: Erst ausprobieren, dann wahrnehmen und erst am Ende reagieren. Neben Social Media, intellektuellem Kapital und Wandlungsfähigkeit spielt in diesem Kontext die IT eine wichtige, neue Rolle.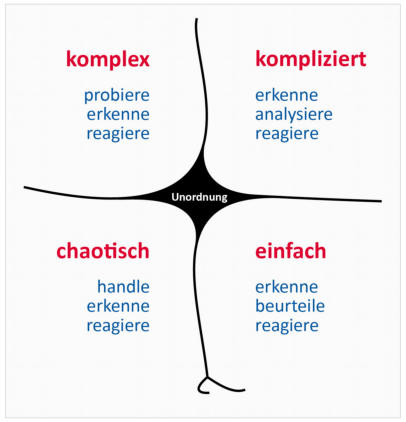
David John Snowden ist Experte für
implizites Wissen und arbeitet als
Dozent, Berater und Wissenschaftler.
Im Rahmen des Cynefin-Frameworks
werden Probleme nach ihrer Art
klassifiziert und ein entsprechender
Umgang mit ihnen vorgeschlagen:
•
Einfache Probleme basieren auf
klaren Ursache-Wirkungs-
Beziehungen: Wenn eine
bestimmte Ausgangssituation
beobachtet wird, kann auf Grund
von Erfahrungen (“Best Practices”)
eine angemessene Reaktion
stattfinden.
•
Bei komplizierten Problemen
müssen Ausgangssituationen
intensiver analysiert werden,
bevor darauf reagiert werden
kann. Dabei gibt es häufig
verschiedene Arten zu reagieren,
die ähnlich gut sind (“Good
Practices”).
•
Komplexe Fragestellungen
werden dadurch charakterisiert,
dass aufgrund einer
Ausgangssituation die Wirkung
bestimmter Maßnahmen nicht
vorhersehbar ist. Somit wird als
Handlungsempfehlung eine
experimentelle
Herangehensweise
(“ausprobieren, wahrnehmen,
reagieren”) vorgeschlagen
(“Emergent Practices”).
•
Chaotische Problemstellungen
sind so geartet, dass gar keine
Ursache-Wirkungs-Beziehungen
aufgestellt werden können. Somit
ist die Handlungsempfehlung
agieren, wahrnehmen, reagieren
mit dem Ziel, das System zu
stabilisieren. Dabei entstehen
Erfahrungen im Sinne einer
“Novel Practice”.
Leitkonzepte, Leitbilder,
Leitideen
Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission
und Ziele) und Leitideen basieren auf
Weltbildern (d.h. Weltanschauung &
Menschenbild von Individuen).
Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept,
Leitbilder) wird bei einem grundlegenden
Wandel durch Adaption (als eine evolutionäre
Eigenschaft) an die Umwelt angepasst (siehe
die Realität des Wandels). Dies geschieht (aus
wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form eines
Paradigmenwechsels.
Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit
durch Visionäre Strategien (auch Alternativen)
Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit,
das deren wesentlichen Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des
konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das
Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist insbesondere
im Kontext sozialer
Systeme anzustreben.
Kurzbeschreibung der Inhalte


Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.
Leitkonzepte
(als grundlegende Werte)

Entscheidertypen
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:
Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen
Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege
zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und
alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn
Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede
Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur
Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der
Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische
Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:
1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und
3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee
Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.
Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen
Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)
und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.
Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).
Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird
bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als
eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt
angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies
geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form
eines Paradigmenwechsels.
Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch
Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem
ganzheitlichen Konzept.
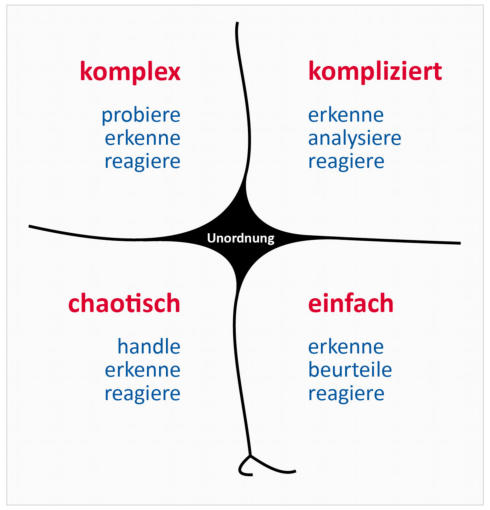
“Novel Practice”
“Emergent Practices“

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept
Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit,
das deren wesentlichen Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des
konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das
Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist insbesondere
im Kontext sozialer
Systeme anzustreben.
Kurzbeschreibung der Inhalte

Ganzheitliches Management
Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Entscheidertypen
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:
Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen
Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege
zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und
alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn
Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede
Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur
Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der
Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische
Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:
1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und
3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee
Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.
Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen
Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)
und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.
Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).
Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird
bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als
eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt
angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies
geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form
eines Paradigmenwechsels.
Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch
Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem
ganzheitlichen Konzept.
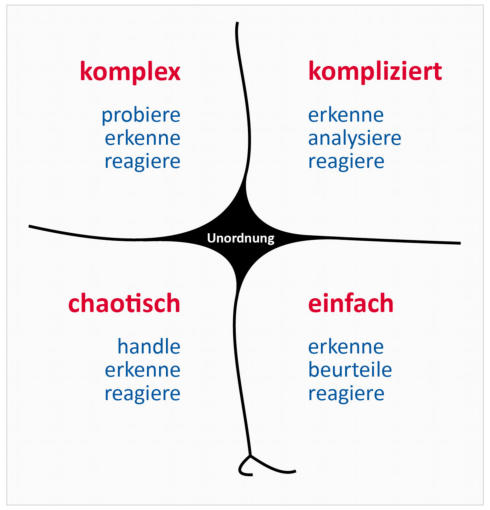
“Novel Practice”
“Emergent Practices“

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept

Leitkonzepte
(als grundlegende Werte)
Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker auf einer
grundlegenden Werte-Ebene. Das ausformulierte Leitkonzept
hat die Aufgabe als eine Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die
Entwicklung von Methoden und die Ausgestaltung von
Leitbildern auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die
allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere Vorstellungen zur
Umsetzung. Leitkonzepten liegen oft “Weltbilder” zu Grunde.
Auf diese “Weltbildebene” ist z. B. auch die Vorstellung
anzusiedeln, dass man “von der Natur lernen” kann.