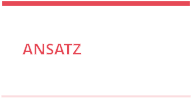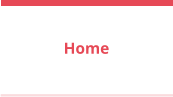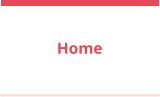Kluge Leute lernen auch von ihren Feinden.
Aristoteles, griechischer Philosophlosoph

















Integrativer Pluralismus -
Die neue Art des Verstehens
Die These der US-Philosophin Sandra Mitchell lautet: Komplexität liegt nicht außerhalb unseres Verständnisvermögens, aber sie erfordert eine neue Art des Verstehens. Sie verlangt, dass man im Einzelnen analysiert, in welch vielfältiger Weise der Zusammenhang dazu beiträgt, die Naturphänomene zu prägen. Historische Kontingenz („Möglichkeit“) schafft im Zusammenwirken mit Zufallsepisoden die tatsächlichen Formen und Verhaltensweisen, mit denen das Lebendige unseren Planeten bevölkert (Kontingenztheorie der Evolution).Philosophie und Erkenntnistheorie -
Erkenntnis ist schöpferisch konstruiert
Die Erkenntnistheorie ist eine philosophische Disziplin, die sich mit der Art und Weise auseinandersetzt, wie wir Wissen gewinnen und die herausfinden will, ob wir überhaupt etwas wissen können. Allerdings muss berücksichtigt werden, Erkenntnis entstammt menschlichen Gehirnen und kann ohne solche nicht weitergegeben oder verstanden werden, sie existiert per se (als Idee) weder materiell noch immateriell (auch nicht im Sinn einer Wechselwirkung) und ist in diesem Sinn schöpferisch konstruiert und man sollte zwischen Konstrukt und (möglicher) Realität unterscheiden um Irrtümern oder voreiligen Schlüssen zu entgehen.Ganzheitliche Philosophie -
Newton´sche Naturwissenschaft vs.
Weltbild des Aristoteles
Der Biochemiker Erwin Chargaff, wirft der Naturwissenschaft den Verlust der Wirklichkeit vor, da sie nur diejenigen Teile der Natur als wirklich ansieht, die erforschbar sind. Chargaff sieht in der "Wiederentdeckung der Wirklichkeit" die einzige Alternative, um zu einer neuen Art von Naturwissenschaft zu kommen und die verheerenden Folgen, welche die jetzige nach sich zieht, zu verhindern. Aus der Sicht der Erkenntnistheorie ruht die Naturwissenschaft auf drei Säulen, die mit den Schlagworten Empirie, Theorie und Weltbild bezeichnet werden können. Die Generalrichtung, in der sich diese Wissenschaft derzeit vorwärts bewegt, wird nicht von dem empirisch Erforschten oder den darauf gegründeten Theorien bestimmt, sondern von dem materialistischen Weltbild, dem sie sich verpflichtet hat.Das Moderne Weltbild der
Evolutionsbiologie
Entstanden aus der Evolutionsbiologie - Vor allem vier Aussagen in Darwins Evolutionstheorie scheinen besonders wichtig zu sein, weil sie über die Biologie hinaus wirkten. 1. Biologische Arten verändern sich – das, was wir heute unter Evolution verstehen. 2. Evolutionslinien zweigen sich auf – was zugleich bedeutet, dass alles Leben der Erde auf einen einzigen gemeinsamen Ursprung zurückgeht. 3. Die Evolution verläuft graduell, in kleinen Schritten, ohne Riesensprünge oder gar Brüche. 4. Der entscheidende Mechanismus, mit dem die Evolution operiert, ist die "natürliche Selektion" ("natürliche Auslese").Holismus - Ganzheit als System der
Philosophie
Der Holismus bzw. die Ganzheitslehre nimmt an, dass die Elemente eines Systems – einer „Ganzheit“ – durch die Strukturbeziehungen nicht vollständig bestimmt sind; es ist die entgegengesetzte Position zum Reduktionismus (Materialismus, Mechanismus). Ganzheit in der Philosophie ist die auf die - Vielfalt angewandte - Einheit; und die Teile sind die Vielfalt selbst. Das Ganze, als etwas Gegliedertes und Zusammengefügtes, nennt man System. Das Gleichgewicht kann bei offenen Systemen (z.B. Unternehmen) auch durch ein so genanntes Fließgleichgewicht (dynamisches Gleichgewicht) hergestellt werden.
Synthetische Evolutionstheorie -
Entstehung der Arten und ihre Adaption
Dies ist ein empirischer Erkenntnisansatz, der
einzelwissenschaftliche und philosophische Erkenntnisse in
fruchtbarer Weise miteinander verbindet, und der von der
empirischen Tatsache ausgeht, dass unsere kognitiven Strukturen
(wie Sinnesorgane, Zentralnervensystem, Gehirn und
Lerndispositionen etc.),
mit deren Hilfe wir die objektiven Strukturen
(der realen Welt) intern rekonstruieren, in hervorragender Weise auf
die Umwelt passen, zum Teil sogar mit ihr übereinstimmen
(dies wird
als Schlüssel-Schloss-Prinzip bezeichnet).
Die Synthetische Evolutionstheorie vereint die Erkenntnisse
aus Darwins Evolutionstheorie mit denen der Ökologie,
Paläontologie, biologischen Systematik und der Genetik.
Insbesondere die Vererbungslehre (Genetik) war zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung von Darwins "On the Origin of
Species" 1859 noch gänzlich unbekannt. Erst die Erkenntnisse
von Gregor Mendel öffneten Tür und Tor für die Wissenschaft
hinsichtlich der Vererbung von Merkmalen und der
evolutionären Anpassung des Menschen.
Menschenbilder und Weltbilder
Wissenschaftlich unterscheidet man drei Menschenbildmodelle: 1. Mechanistische Modelle basieren auf der Maschinenmetapher (der Mensch als Maschine). 2. Organismische Modelle (der Mensch als biologisches System). 3. Reflexive Subjektmodelle (z.B. der Mensch als rational Handelnder) Das moderne Weltbild wird heute in der Wissenschaft durch das Menschenbild der Evolutionsbiologie geprägt, was auch Auswirkungen auf die Wirtschaftswissenschaften hat (z.B. auf den „homo oeconomicus“ der Volkswirtschaftslehre).Kultureller Ansatz - Drei ewige Fragen
Die kulturellen Paradigma leiten sich nach Lipton und Bhaerman daraus ab, wie eine Gesellschaft die drei ewigen Fragen beantwortet: 1. Wie sind wir entstanden? 2. Wozu sind wir hier? 3. Wie können wir das Beste aus unserem Dasein machen? In westlichen Wirtschaftssystemen konkurrieren auf der kulturellen Ebene vor allem a) Materialismus und b) Holismus (Ganzheitlichkeit) miteinander. a) Altes Paradigma: Kartesianisch-newtonsche Sicht der Realität. b) Neues Paradigma: Die ganzheitliche Sicht der Realität als Verknüpfung von Geist und Materie.Wissenschaftlicher Ansätze - Paradigmen
1. Altes Paradigma: Charakteristisch für den kartesianisch- newtonschen Denkrahmen ist ein strikter Dualismus, der etwa Körper und Psyche, Materie und Geist undifferenziert gegenüberstellt (reduktionistisches Denken). 2. Neues Paradigma (die ganzheitliche Sicht der Realität). Insbesondere die Erkenntnisse der modernen Physik haben die Newtonschen Grundannahmen über die Materie, die Energie und das Objektivitätspostulat relativiert. Mit der Relativitätstheorie und Quantenmechanik wurden die Grundelemente der Newtonschen Physik in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt oder durch neue Erkenntnisse ausgeweitet.Systemtheorie -
System als Modell der Natur/
des Denkens
Ein System bezeichnet einen Zusammenhang von Elementen, deren Beziehungen untereinander sich quantitativ und qualitativ unterscheiden von Beziehungen zu anderen Elementen (dadurch ist eine Grenze zur Systemumwelt beobachtbar). Systeme können unterschieden werden nach 1. Maschinen, 2. lebenden, 3. psychischen und 4. sozialen Systemen. Soziale Systeme (Interaktionen, Organisationen und die Gesellschaft) produzieren, reproduzieren und erhalten Kommunikationen. Sie operieren im Medium Sinn (Systemtheorie nach Niklas Luhmann).
Selbstorganisation - Organisation des Lebens
Als Selbstorganisation wird hauptsächlich in der Systemtheorie
eine Form der Systementwicklung bezeichnet, bei der die
gestaltenden und beschränkenden Einflüsse von den Elementen
des sich organisierenden Systems selbst ausgehen
(Selbstorganisation). Gebraucht wird der Begriff auch für die
Gestaltung des Lebens an sich nach nicht festen, von anderen
bestimmten Regeln und ähnelt daher dem Autonomiebegriff. Die
untersuchten Systeme bringen räumliche, zeitliche, raumzeitliche
oder funktionale Strukturen durch Selbstorganisation, und das
ohne direkte ordnende Eingriffe von außen.
Evolutionäre Erkenntnistheorie -
Die reale Welt wird intern rekonstruiert
Emergenz - Das interdisziplinäre Konzept
Emergenz ist die Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen (Übersummativität). So wird von einigen Philosophen die Meinung vertreten, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns sei. Emergente Phänomene sind z..B. kollektive Intelligenz von Menschen und Schwarmintelligenz bei Wildenten.Radikaler Konstruktivismus -
Die Theorie des Wissens
Der Radikale Konstruktivismus wird als eine Theorie des Wissens verstanden. In den letzten Jahren haben sich die vom Radikalen Konstruktivismus ausgehenden Ideen über Selbsterzeugung, Selbstorganisation und Selbstreferenz als äußerst fruchtbar erwiesen. Auf dieser Grundlage haben z.B. Philosophen und Psychologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Biologen und Neurophysiologen, Juristen und Ethnologen, Psychotherapeuten und Kunstwissenschaftler sowie Soziologen und Ingenieure ihre Disziplinen erneuert und erweitert.
Weltanschauung
Weltanschauung ist die Gesamtheit der Ansichten, die man über
Wesen und Bedeutung des Weltganzen, den Menschen
inbegriffen, hat; Oberbegriff für alle Religionen, Ideologien,
öffentlichen Meinungen und Gesinnungen (Weltbilder). Eine
Weltanschauung beinhaltet Deutungsauffassungen und ist ein
persönliches Ordnungssystem (Persönlichkeit), das aufnehmende
Informationen steuert und integriert.
Weltanschauungen sind z.B.
•
individuumszentriert (z.B. Humanismus),
•
gesellschaftlich orientiert (z.B. Sozialismus),
•
zukunftsorientiert
(Sorge für das Leben der Nachkommen),
•
religiös ausgerichtet (z.B. Religionen) oder
•
beziehen sich auf Philosophien
(z.B. Materialismus, Holismus und
Pragmatismus).
Aus:
lexikon/psychologie/
weltanschauung
Menschenbild und Entwicklung
Wer in seiner psychosozialen Entwicklung nicht zu einer
weitgehend selbständigen und selbstbestimmten Person, zu
einer eigenen Identität findet, verbleibt bzw. flüchtet in ein
außengeleitetes, gehorsam-angepasstes Verhalten. Fromm nennt
als typische Züge dieser Psychodynamik: Autoritarismus,
Destruktivität, Rückzug, (Selbstausdehnung) und Konformität.
Aus:
lexikon/psychologie/ Menschenbild und Entwicklung
Das moderne Menschenbild
Das moderne Weltbild wird heute in der Wissenschaft durch
das Menschenbild der Evolutionsbiologie geprägt (siehe „Das
moderne Bild der Evolutionsbiologie“.
Weltbilder
Sichtweisen der Welt, d.h. grundlegende kognitive Konzepte
der materiellen, sozialen und transzendenten Wirklichkeit, die
als Überzeugungssystem sozial vermittelt, rezipiert und in
einer rekonstruktiven Leistung individuell angeeignet werden.
Dazu gehören
1.
Auffassungen über die Entstehung der Welt und des
Lebens (Kosmologie): Urknalltheorie, Evolutionstheorie
vs. naiver Schöpfungsglaube;
2.
Fragen nach Wesen und Struktur der Wirklichkeit
(Ontologie): Kausalitätsverständnis; kindliche
Auffassungen, alle Dinge seien lebendig und beseelt,
seien von irgendjemandem "gemacht" und dienten
immer einem Zweck (Animismus, Artifizialismus und
Finalismus) (Aberglaube, Parapsychologie);
3.
Wissenschaftsverständnis: Erkenntnis-Skeptizismus vs.
Wissenschaftsgläubigkeit ("Scientism");
4.
Fragen nach einer transzendenten Wirklichkeit
(Metaphysik): Gottesbild vs. Atheismus; Auffassungen
über Tod und Ewigkeit (Transpersonale Psychologie);
5.
Auffassungen über die Natur des Menschen
(Menschenbilder);
6.
Kohärente und konsistente Vorstellungen über die
gesellschaftliche Wirklichkeit (Gesellschaftsbilder), z.B.
Vorstellungen über soziale Verteilungs- und
Chancenungleichheiten und über deren Legitimität.
Weltbilder werden als Hintergrundbedingung für die
"angewandten" moralischen und religiösen Urteile aufgefasst.
Existentielle Erfahrungen können aber auch zunächst das
religiöse Urteil und – gleichsam rückwirkend – das Weltbild
verändern. Die Entwicklung verläuft von naiven,
egozentrischen, eindimensionalen zu realitätsorientierten,
komplexen und differenzierten Weltbildern. Quer zu den
verschiedenen Facetten von Weltbildern entwickelt sich die
Grundfähigkeit, scheinbar unvereinbare Aspekte oder
Erklärungsansätze gleichzeitig zu berücksichtigen und in einer
komplexeren Perspektive zu integrieren, beispielsweise
biblischen Schöpfungsglauben und naturwissenschaftliche
Betrachtung, Kausalität und Finalität ("Komplementarität"
nach Oser & Reich, 1986). Aufgabe der Erziehung ist es, diese
Entwicklung zu komplexem und komplementärem Denken zu
unterstützen.
Aus:
lexikon/psychologie/weltbilder
Ansätze , d.h. philosophisch - kulturelle und wissenschaftliche, können auf Einzeldisziplinen (z.B. Philosophie, Natur- und
Wirtschaftswissenschaften) und auf interdisziplinäre Theorien (mit Prinzipien und Methoden, etc.) zurückgeführt werden.
Als
Einzeldisziplin ist z.B. die Erkenntnistheorie (Erkenntnis ist schöpferisch konstruiert) - als Teil der Philosophie - zu nennen; als
interdisziplinär gelten insbesondere die Systemtheorie (als Modell der Natur/des Denkens), Synthetische Evolutionstheorie (für
natürliche Entwicklungen des Lebens, d.h. Entstehung der Arten und ihre Adaption), Evolutionäre Erkenntnistheorie (die reale Welt
wird intern rekonstruiert) und der Radikale Konstruktivismus (als Theorie des Wissens). Durch diese Ansätze werden Wertesysteme
erzeugt.
Neben den evolutionären Theorien gibt es auch revolutionäre Theorien und Thesen, die bisher allerdings keine interdisziplinäre
Anerkennung fanden (z.B. die Revolutionstheorie von Marx, die Revolutionstheorie für das 21. Jahrhundert); gleichwohl haben
sich in Wirtschaft und Gesellschaft (Politik) Interpretationen des Begriffes „Revolution“ und damit verknüpfte Prinzipien und
Methoden verbreitet, häufig im Kontext mit den Begriffen „Wandel“ und und „Evolution“, letztere auch als konträre
Gegenüberstellung.
Anmerkung zur Ökonomie: „Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft“
„In den mathematischen Naturwissenschaften liegt die Verbindung zwischen Mathematik und Realität im Experiment, in dem
die mathematischen Idealbedingungen im Labor erst hergestellt werden. Nur dort tritt ein mathematisches Naturgesetz in
seiner vollen Pracht und Herrlichkeit überhaupt in Erscheinung. Oder eben auch nicht, was dann zur Revision der zugrunde
liegenden Theorie führt. Was macht nun aber ein Fach wie die Ökonomie, in dem Experimente nicht möglich sind, sondern
allenfalls Beobachtungen? Hier fällt das mit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode verbundene
Wahrheitskriterium weg - doch was tritt dann an seine Stelle? Daraus ergeben sich schwierige methodische Fragen. Was ich den
mathematischen Ökonomen zum Vorwurf mache und mich an ihrem Vorgehen wirklich stört, das ist, dass sie sich mit diesem
Problem gar nicht erst auseinandersetzen…“
Prof. Claus Peter Ortlieb, FB Mathematik der Uni Hamburg in einem Interview mit der FAZ, 08.05.2010
Kurzbeschreibung der Inhalte
Am Anfang war der Himmelshaken
Am Anfang war der Geist (Himmelshaken) „Die Materie – die nicht denkende Materie und Bewegung – kann niemals das Denken erzeugen, gleichviel, welche Veränderungen von Gestalt und Größe sie auch hervorrufen mag. Die Erzeugung des Wissens wird immer ebenso weit über das Vermögen der Bewegung und der Materie hinausgehen, wie die Erzeugung der Materie über das Vermögen des Nichts oder des Nichtseienden.“ (Locke 1690: Über den menschlichen Verstand [nach Dennett[1995] 1997: Darwins gefährliches Erbe])
Ansätze , d.h. philosophisch -
kulturelle und wissenschaftliche,
können auf Einzeldisziplinen (z.B.
Philosophie, Natur- und
Wirtschaftswissenschaften) und auf
interdisziplinäre Theorien (mit
Prinzipien und Methoden, etc.)
zurückgeführt werden.
Als
Einzeldisziplin ist z.B. die
Erkenntnistheorie (Erkenntnis ist
schöpferisch konstruiert) - als Teil
der Philosophie - zu nennen; als
interdisziplinär gelten insbesondere
die Systemtheorie (als Modell der
Natur/des Denkens), Synthetische
Evolutionstheorie (für natürliche
Entwicklungen des Lebens, d.h.
Entstehung der Arten und ihre
Adaption), Evolutionäre
Erkenntnistheorie (die reale Welt wird
intern rekonstruiert) und der Radikale
Konstruktivismus (als Theorie des
Wissens). Durch diese Ansätze
werden Wertesysteme erzeugt.
Neben den evolutionären Theorien
gibt es auch revolutionäre Theorien
und Thesen, die bisher allerdings
keine interdisziplinäre Anerkennung
fanden (z.B. die Revolutionstheorie
von Marx, die Revolutionstheorie
für das 21. Jahrhundert); gleichwohl
haben sich in Wirtschaft und
Gesellschaft (Politik)
Interpretationen des Begriffes
„Revolution“ und damit verknüpfte
Prinzipien und Methoden
verbreitet, häufig im Kontext mit
den Begriffen „Wandel“ und und
„Evolution“, letztere auch als
konträre Gegenüberstellung.
Anmerkung zur Ökonomie:
„Ökonomie ist eigentlich keine Wiss
enschaft“
„In den mathematischen
Naturwissenschaften liegt die
Verbindung zwischen Mathematik
und Realität im Experiment, in dem
die mathematischen
Idealbedingungen im Labor erst
hergestellt werden. Nur dort tritt
ein mathematisches Naturgesetz in
seiner vollen Pracht und
Herrlichkeit überhaupt in
Erscheinung. Oder eben auch nicht,
was dann zur Revision der
zugrunde liegenden Theorie führt.
Was macht nun aber ein Fach wie
die Ökonomie, in dem Experimente
nicht möglich sind, sondern
allenfalls Beobachtungen? Hier fällt
das mit der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Methode
verbundene Wahrheitskriterium
weg - doch was tritt dann an seine
Stelle? Daraus ergeben sich
schwierige methodische Fragen.
Was ich den mathematischen
Ökonomen zum Vorwurf mache
und mich an ihrem Vorgehen
wirklich stört, das ist, dass sie sich
mit diesem Problem gar nicht erst
auseinandersetzen…“
Prof. Claus Peter Ortlieb, FB
Mathematik der Uni Hamburg in
einem Interview mit der FAZ,
08.05.2010
Kurzbeschreibung der Inhalte
Holismus - Ganzheit als System der
Philosophie
Der Holismus bzw. die Ganzheitslehre nimmt an, dass die Elemente eines Systems – einer „Ganzheit“ – durch die Strukturbeziehungen nicht vollständig bestimmt sind; es ist die entgegengesetzte Position zum Reduktionismus (Materialismus, Mechanismus). Ganzheit in der Philosophie ist die auf die - Vielfalt angewandte - Einheit; und die Teile sind die Vielfalt selbst. Das Ganze, als etwas Gegliedertes und Zusammengefügtes, nennt man System. Das Gleichgewicht kann bei offenen Systemen (z.B. Unternehmen) auch durch ein so genanntes Fließgleichgewicht (dynamisches Gleichgewicht) hergestellt werden.
Philosophie und Erkenntnistheorie -
Erkenntnis ist schöpferisch
konstruiert
Die Erkenntnistheorie ist eine philosophische Disziplin, die sich mit der Art und Weise auseinandersetzt, wie wir Wissen gewinnen und die herausfinden will, ob wir überhaupt etwas wissen können. Allerdings muss berücksichtigt werden, Erkenntnis entstammt menschlichen Gehirnen und kann ohne solche nicht weitergegeben oder verstanden werden, sie existiert per se (als Idee) weder materiell noch immateriell (auch nicht im Sinn einer Wechselwirkung) und ist in diesem Sinn schöpferisch konstruiert und man sollte zwischen Konstrukt und (möglicher) Realität unterscheiden um Irrtümern oder voreiligen Schlüssen zu entgehen.Ganzheitliche Philosophie -
Newton´sche Naturwissenschaft
vs. Weltbild des Aristoteles
Der Biochemiker Erwin Chargaff, wirft der Naturwissenschaft den Verlust der Wirklichkeit vor, da sie nur diejenigen Teile der Natur als wirklich ansieht, die erforschbar sind. Chargaff sieht in der "Wiederentdeckung der Wirklichkeit" die einzige Alternative, um zu einer neuen Art von Naturwissenschaft zu kommen und die verheerenden Folgen, welche die jetzige nach sich zieht, zu verhindern. Aus der Sicht der Erkenntnistheorie ruht die Naturwissenschaft auf drei Säulen, die mit den Schlagworten Empirie, Theorie und Weltbild bezeichnet werden können. Die Generalrichtung, in der sich diese Wissenschaft derzeit vorwärts bewegt, wird nicht von dem empirisch Erforschten oder den darauf gegründeten Theorien bestimmt, sondern von dem materialistischen Weltbild, dem sie sich verpflichtet hat.Kultureller Ansatz - Drei ewige
Fragen
Die kulturellen Paradigma leiten sich nach Lipton und Bhaerman daraus ab, wie eine Gesellschaft die drei ewigen Fragen beantwortet: 1. Wie sind wir entstanden? 2. Wozu sind wir hier? 3. Wie können wir das Beste aus unserem Dasein machen? In westlichen Wirtschaftssystemen konkurrieren auf der kulturellen Ebene vor allem a) Materialismus und b) Holismus (Ganzheitlichkeit) miteinander. a) Altes Paradigma: Kartesianisch-newtonsche Sicht der Realität. b) Neues Paradigma: Die ganzheitliche Sicht der Realität als Verknüpfung von Geist und Materie.Menschenbilder und Weltbilder
Wissenschaftlich unterscheidet man drei Menschenbildmodelle: 1. Mechanistische Modelle basieren auf der Maschinenmetapher (der Mensch als Maschine). 2. Organismische Modelle (der Mensch als biologisches System). 3. Reflexive Subjektmodelle (z.B. der Mensch als rational Handelnder) Das moderne Weltbild wird heute in der Wissenschaft durch das Menschenbild der Evolutionsbiologie geprägt, was auch Auswirkungen auf die Wirtschaftswissenschaften hat (z.B. auf den „homo oeconomicus“ der Volkswirtschaftslehre).Das Moderne Weltbild der
Evolutionsbiologie
Entstanden aus der Evolutionsbiologie - Vor allem vier Aussagen in Darwins Evolutionstheorie scheinen besonders wichtig zu sein, weil sie über die Biologie hinaus wirkten. 1. Biologische Arten verändern sich – das, was wir heute unter Evolution verstehen. 2. Evolutionslinien zweigen sich auf – was zugleich bedeutet, dass alles Leben der Erde auf einen einzigen gemeinsamen Ursprung zurückgeht. 3. Die Evolution verläuft graduell, in kleinen Schritten, ohne Riesensprünge oder gar Brüche. 4. Der entscheidende Mechanismus, mit dem die Evolution operiert, ist die "natürliche Selektion" ("natürliche Auslese").Wissenschaftlicher Ansätze -
Paradigmen
1. Altes Paradigma: Charakteristisch für den kartesianisch-newtonschen Denkrahmen ist ein strikter Dualismus, der etwa Körper und Psyche, Materie und Geist undifferenziert gegenüberstellt (reduktionistisches Denken). 2. Neues Paradigma (die ganzheitliche Sicht der Realität). Insbesondere die Erkenntnisse der modernen Physik haben die Newtonschen Grundannahmen über die Materie, die Energie und das Objektivitätspostulat relativiert. Mit der Relativitätstheorie und Quantenmechanik wurden die Grundelemente der Newtonschen Physik in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt oder durch neue Erkenntnisse ausgeweitet.Systemtheorie -
System als Modell der Natur/
des Denkens
Ein System bezeichnet einen Zusammenhang von Elementen, deren Beziehungen untereinander sich quantitativ und qualitativ unterscheiden von Beziehungen zu anderen Elementen (dadurch ist eine Grenze zur Systemumwelt beobachtbar). Systeme können unterschieden werden nach 1. Maschinen, 2. lebenden, 3. psychischen und 4. sozialen Systemen. Soziale Systeme (Interaktionen, Organisationen und die Gesellschaft) produzieren, reproduzieren und erhalten Kommunikationen. Sie operieren im Medium Sinn (Systemtheorie nach Niklas Luhmann).
Selbstorganisation - Organisation
des Lebens
Als Selbstorganisation wird hauptsächlich in der
Systemtheorie eine Form der Systementwicklung
bezeichnet, bei der die gestaltenden und
beschränkenden Einflüsse von den Elementen des
sich organisierenden Systems selbst ausgehen
(Selbstorganisation). Gebraucht wird der Begriff
auch für die Gestaltung des Lebens an sich nach
nicht festen, von anderen bestimmten Regeln und
ähnelt daher dem Autonomiebegriff. Die
untersuchten Systeme bringen räumliche,
zeitliche, raumzeitliche oder funktionale
Strukturen durch Selbstorganisation, und das
ohne direkte ordnende Eingriffe von außen.
Emergenz - Das interdisziplinäre
Konzept
Emergenz ist die Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen (Übersummativität). So wird von einigen Philosophen die Meinung vertreten, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns sei. Emergente Phänomene sind z..B. kollektive Intelligenz von Menschen und Schwarmintelligenz bei Wildenten.
Synthetische Evolutionstheorie -
Entstehung der Arten und ihre Adaption
Die Synthetische Evolutionstheorie vereint die
Erkenntnisse aus Darwins Evolutionstheorie mit
denen der Ökologie, Paläontologie, biologischen
Systematik und der Genetik. Insbesondere die
Vererbungslehre (Genetik) war zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung von Darwins "On the Origin of
Species" 1859 noch gänzlich unbekannt. Erst die
Erkenntnisse von Gregor Mendel öffneten Tür und
Tor für die Wissenschaft hinsichtlich der Vererbung
von Merkmalen und der evolutionären Anpassung
des Menschen.
Dies ist ein empirischer Erkenntnisansatz, der
einzelwissenschaftliche und philosophische
Erkenntnisse in fruchtbarer Weise miteinander
verbindet, und der von der empirischen Tatsache
ausgeht, dass unsere kognitiven Strukturen (wie
Sinnesorgane, Zentralnervensystem, Gehirn und
Lerndispositionen etc.),
mit deren Hilfe wir die
objektiven Strukturen (der realen Welt) intern
rekonstruieren, in hervorragender Weise auf die
Umwelt passen, zum Teil sogar mit ihr übereinstimmen
(dies wird als Schlüssel-Schloss-Prinzip bezeichnet).
Evolutionäre Erkenntnistheorie -
Die reale Welt wird intern rekonstruiert
Radikaler Konstruktivismus -
Die Theorie des Wissens
Der Radikale Konstruktivismus wird als eine Theorie des Wissens verstanden. In den letzten Jahren haben sich die vom Radikalen Konstruktivismus ausgehenden Ideen über Selbsterzeugung, Selbstorganisation und Selbstreferenz als äußerst fruchtbar erwiesen. Auf dieser Grundlage haben z.B. Philosophen und Psychologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Biologen und Neurophysiologen, Juristen und Ethnologen, Psychotherapeuten und Kunstwissenschaftler sowie Soziologen und Ingenieure ihre Disziplinen erneuert und erweitert.Integrativer Pluralismus -
Die neue Art des Verstehens
Die These der US-Philosophin Sandra Mitchell lautet: Komplexität liegt nicht außerhalb unseres Verständnisvermögens, aber sie erfordert eine neue Art des Verstehens. Sie verlangt, dass man im Einzelnen analysiert, in welch vielfältiger Weise der Zusammenhang dazu beiträgt, die Naturphänomene zu prägen. Historische Kontingenz („Möglichkeit“) schafft im Zusammenwirken mit Zufallsepisoden die tatsächlichen Formen und Verhaltensweisen, mit denen das Lebendige unseren Planeten bevölkert (Kontingenztheorie der Evolution).Am Anfang war der Himmelshaken
Am Anfang war der Geist (Himmelshaken) „Die Materie – die nicht denkende Materie und Bewegung – [kann] niemals das Denken erzeugen, gleichviel, welche Veränderungen von Gestalt und Größe sie auch hervorrufen mag. Die Erzeugung des Wissens wird immer ebenso weit über das Vermögen der Bewegung und der Materie hinausgehen, wie die Erzeugung der Materie über das Vermögen des Nichts oder des Nichtseienden.“ (Locke 1690: Über den menschlichen Verstand [nach Dennett[1995] 1997: Darwins gefährliches Erbe])
Weltbilder
Sichtweisen der Welt, d.h. grundlegende kognitive
Konzepte der materiellen, sozialen und
transzendenten Wirklichkeit, die als
Überzeugungssystem sozial vermittelt, rezipiert und in
einer rekonstruktiven Leistung individuell angeeignet
werden. Dazu gehören
1.
Auffassungen über die Entstehung der Welt und
des Lebens (Kosmologie): Urknalltheorie,
Evolutionstheorie vs. naiver Schöpfungsglaube;
2.
Fragen nach Wesen und Struktur der Wirklichkeit
(Ontologie): Kausalitätsverständnis; kindliche
Auffassungen, alle Dinge seien lebendig und
beseelt, seien von irgendjemandem "gemacht"
und dienten immer einem Zweck (Animismus,
Artifizialismus und Finalismus) (Aberglaube,
Parapsychologie);
3.
Wissenschaftsverständnis: Erkenntnis-
Skeptizismus vs. Wissenschaftsgläubigkeit
("Scientism");
4.
Fragen nach einer transzendenten Wirklichkeit
(Metaphysik): Gottesbild vs. Atheismus;
Auffassungen über Tod und Ewigkeit
(Transpersonale Psychologie);
5.
Auffassungen über die Natur des Menschen
(Menschenbilder);
6.
Kohärente und konsistente Vorstellungen über
die gesellschaftliche Wirklichkeit
(Gesellschaftsbilder), z.B. Vorstellungen über
soziale Verteilungs- und Chancenungleichheiten
und über deren Legitimität.
Weltbilder werden als Hintergrundbedingung für die
"angewandten" moralischen und religiösen Urteile
aufgefasst. Existentielle Erfahrungen können aber
auch zunächst das religiöse Urteil und – gleichsam
rückwirkend – das Weltbild verändern. Die
Entwicklung verläuft von naiven, egozentrischen,
eindimensionalen zu realitätsorientierten, komplexen
und differenzierten Weltbildern. Quer zu den
verschiedenen Facetten von Weltbildern entwickelt
sich die Grundfähigkeit, scheinbar unvereinbare
Aspekte oder Erklärungsansätze gleichzeitig zu
berücksichtigen und in einer komplexeren Perspektive
zu integrieren, beispielsweise biblischen
Schöpfungsglauben und naturwissenschaftliche
Betrachtung, Kausalität und Finalität
("Komplementarität" nach Oser & Reich, 1986).
Aufgabe der Erziehung ist es, diese Entwicklung zu
komplexem und komplementärem Denken zu
unterstützen.
Aus:
lexikon/psychologie/weltbilder
Das moderne Menschenbild
Das moderne Weltbild wird heute in der Wissenschaft
durch das Menschenbild der Evolutionsbiologie
geprägt (siehe „Das moderne Bild der
Evolutionsbiologie“.
Weltanschauung
Weltanschauung ist die Gesamtheit der Ansichten, die
man über Wesen und Bedeutung des Weltganzen, den
Menschen inbegriffen, hat; Oberbegriff für alle
Religionen, Ideologien, öffentlichen Meinungen und
Gesinnungen (Weltbilder). Eine Weltanschauung
beinhaltet Deutungsauffassungen und ist ein
persönliches Ordnungssystem (Persönlichkeit), das
aufnehmende Informationen steuert und integriert.
Weltanschauungen sind z.B.
•
individuumszentriert (z.B. Humanismus),
•
gesellschaftlich orientiert (z.B. Sozialismus),
•
zukunftsorientiert
(Sorge für das Leben der Nachkommen),
•
religiös ausgerichtet (z.B. Religionen) oder
•
beziehen sich auf Philosophien
(z.B. Materialismus, Holismus und
Pragmatismus).
Aus:
lexikon/psychologie/
weltanschauung
Menschenbild und Entwicklung
Wer in seiner psychosozialen Entwicklung nicht zu einer
weitgehend selbständigen und selbstbestimmten
Person, zu einer eigenen Identität findet, verbleibt bzw.
flüchtet in ein außengeleitetes, gehorsam-angepasstes
Verhalten. Fromm nennt als typische Züge dieser
Psychodynamik: Autoritarismus, Destruktivität, Rückzug,
(Selbstausdehnung) und Konformität.
Aus:
lexikon/psychologie/ Menschenbild und Entwicklung

Weltbilder
Sichtweisen der Welt, d.h. grundlegende kognitive Konzepte
der materiellen, sozialen und transzendenten Wirklichkeit, die
als Überzeugungssystem sozial vermittelt, rezipiert und in
einer rekonstruktiven Leistung individuell angeeignet werden.
Dazu gehören
1.
Auffassungen über die Entstehung der Welt und des
Lebens (Kosmologie): Urknalltheorie, Evolutionstheorie
vs. naiver Schöpfungsglaube;
2.
Fragen nach Wesen und Struktur der Wirklichkeit
(Ontologie): Kausalitätsverständnis; kindliche
Auffassungen, alle Dinge seien lebendig und beseelt,
seien von irgendjemandem "gemacht" und dienten
immer einem Zweck (Animismus, Artifizialismus und
Finalismus) (Aberglaube, Parapsychologie);
3.
Wissenschaftsverständnis: Erkenntnis-Skeptizismus vs.
Wissenschaftsgläubigkeit ("Scientism");
4.
Fragen nach einer transzendenten Wirklichkeit
(Metaphysik): Gottesbild vs. Atheismus; Auffassungen
über Tod und Ewigkeit (Transpersonale Psychologie);
5.
Auffassungen über die Natur des Menschen
(Menschenbilder);
6.
Kohärente und konsistente Vorstellungen über die
gesellschaftliche Wirklichkeit (Gesellschaftsbilder), z.B.
Vorstellungen über soziale Verteilungs- und
Chancenungleichheiten und über deren Legitimität.
Weltbilder werden als Hintergrundbedingung für die
"angewandten" moralischen und religiösen Urteile aufgefasst.
Existentielle Erfahrungen können aber auch zunächst das
religiöse Urteil und – gleichsam rückwirkend – das Weltbild
verändern. Die Entwicklung verläuft von naiven,
egozentrischen, eindimensionalen zu realitätsorientierten,
komplexen und differenzierten Weltbildern. Quer zu den
verschiedenen Facetten von Weltbildern entwickelt sich die
Grundfähigkeit, scheinbar unvereinbare Aspekte oder
Erklärungsansätze gleichzeitig zu berücksichtigen und in einer
komplexeren Perspektive zu integrieren, beispielsweise
biblischen Schöpfungsglauben und naturwissenschaftliche
Betrachtung, Kausalität und Finalität ("Komplementarität"
nach Oser & Reich, 1986). Aufgabe der Erziehung ist es, diese
Entwicklung zu komplexem und komplementärem Denken zu
unterstützen.
Aus:
lexikon/psychologie/weltbilder





Ansätze , d.h. philosophisch - kulturelle und wissenschaftliche, können auf Einzeldisziplinen (z.B.
Philosophie, Natur- und Wirtschaftswissenschaften) und auf interdisziplinäre Theorien (mit Prinzipien
und Methoden, etc.) zurückgeführt werden.
Als Einzeldisziplin ist z.B. die Erkenntnistheorie (Erkenntnis
ist schöpferisch konstruiert) - als Teil der Philosophie - zu nennen; als interdisziplinär gelten insbesondere
die Systemtheorie (als Modell der Natur/des Denkens), Synthetische Evolutionstheorie (für natürliche
Entwicklungen des Lebens, d.h. Entstehung der Arten und ihre Adaption), Evolutionäre Erkenntnistheorie
(die reale Welt wird intern rekonstruiert) und der Radikale Konstruktivismus (als Theorie des Wissens). Durch
diese Ansätze werden Wertesysteme erzeugt.
Neben den evolutionären Theorien gibt es auch revolutionäre Theorien und Thesen, die bisher
allerdings keine interdisziplinäre Anerkennung fanden (z.B. die Revolutionstheorie von Marx, die
Revolutionstheorie für das 21. Jahrhundert); gleichwohl haben sich in Wirtschaft und Gesellschaft
(Politik) Interpretationen des Begriffes „Revolution“ und damit verknüpfte Prinzipien und Methoden
verbreitet, häufig im Kontext mit den Begriffen „Wandel“ und und „Evolution“, letztere auch als
konträre Gegenüberstellung.
Anmerkung zur Ökonomie: „Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft“
„In den mathematischen Naturwissenschaften liegt die Verbindung zwischen Mathematik und Realität
im Experiment, in dem die mathematischen Idealbedingungen im Labor erst hergestellt werden. Nur
dort tritt ein mathematisches Naturgesetz in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit überhaupt in
Erscheinung. Oder eben auch nicht, was dann zur Revision der zugrunde liegenden Theorie führt. Was
macht nun aber ein Fach wie die Ökonomie, in dem Experimente nicht möglich sind, sondern allenfalls
Beobachtungen? Hier fällt das mit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode verbundene
Wahrheitskriterium weg - doch was tritt dann an seine Stelle? Daraus ergeben sich schwierige
methodische Fragen. Was ich den mathematischen Ökonomen zum Vorwurf mache und mich an
ihrem Vorgehen wirklich stört, das ist, dass sie sich mit diesem Problem gar nicht erst
auseinandersetzen…“
Prof. Claus Peter Ortlieb, FB Mathematik der Uni Hamburg in einem Interview mit der FAZ, 08.05.2010
Kurzbeschreibung der Inhalte
Am Anfang war der Geist (Himmelshaken) „Die Materie – die nicht denkende Materie und Bewegung – kann niemals das
Denken erzeugen, gleichviel, welche Veränderungen von Gestalt und Größe sie auch hervorrufen mag. Die Erzeugung des
Wissens wird immer ebenso weit über das Vermögen der Bewegung und der Materie hinausgehen, wie die Erzeugung der
(Locke 1690: Über den menschlichen Verstand [nach Dennett[1995] 1997: Darwins gefährliches Erbe])
Holismus - Ganzheit als System der
Philosophie
Der Holismus bzw. die Ganzheitslehre nimmt an, dass die Elemente eines Systems – einer „Ganzheit“ – durch die Strukturbeziehungen nicht vollständig bestimmt sind; es ist die entgegengesetzte Position zum Reduktionismus (Materialismus, Mechanismus). Ganzheit in der Philosophie ist die auf die - Vielfalt angewandte - Einheit; und die Teile sind die Vielfalt selbst. Das Ganze, als etwas Gegliedertes und Zusammengefügtes, nennt man System. Das Gleichgewicht kann bei offenen Systemen (z.B. Unternehmen) auch durch ein so genanntes Fließgleichgewicht (dynamisches Gleichgewicht) hergestellt werden.
Kultureller Ansatz - Drei ewige Fragen
Die kulturellen Paradigma leiten sich nach Lipton und Bhaerman daraus ab, wie eine Gesellschaft die drei ewigen Fragen beantwortet: 1. Wie sind wir entstanden? 2. Wozu sind wir hier? 3. Wie können wir das Beste aus unserem Dasein machen? In westlichen Wirtschaftssystemen konkurrieren auf der kulturellen Ebene vor allem a) Materialismus und b) Holismus (Ganzheitlichkeit) miteinander. a) Altes Paradigma: Kartesianisch-newtonsche Sicht der Realität. b) Neues Paradigma: Die ganzheitliche Sicht der Realität als Verknüpfung von Geist und Materie.Wissenschaftlicher Ansätze - Paradigmen
1. Altes Paradigma: Charakteristisch für den kartesianisch- newtonschen Denkrahmen ist ein strikter Dualismus, der etwa Körper und Psyche, Materie und Geist undifferenziert gegenüberstellt (reduktionistisches Denken). 2. Neues Paradigma (die ganzheitliche Sicht der Realität). Insbesondere die Erkenntnisse der modernen Physik haben die Newtonschen Grundannahmen über die Materie, die Energie und das Objektivitätspostulat relativiert. Mit der Relativitätstheorie und Quantenmechanik wurden die Grundelemente der Newtonschen Physik in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt oder durch neue Erkenntnisse ausgeweitet.Emergenz - Das interdisziplinäre Konzept
Emergenz ist die Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen (Übersummativität). So wird von einigen Philosophen die Meinung vertreten, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns sei. Emergente Phänomene sind z..B. kollektive Intelligenz von Menschen und Schwarmintelligenz bei Wildenten.Radikaler Konstruktivismus -
Die Theorie des Wissens
Der Radikale Konstruktivismus wird als eine Theorie des Wissens verstanden. In den letzten Jahren haben sich die vom Radikalen Konstruktivismus ausgehenden Ideen über Selbsterzeugung, Selbstorganisation und Selbstreferenz als äußerst fruchtbar erwiesen. Auf dieser Grundlage haben z.B. Philosophen und Psychologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Biologen und Neurophysiologen, Juristen und Ethnologen, Psychotherapeuten und Kunstwissenschaftler sowie Soziologen und Ingenieure ihre Disziplinen erneuert und erweitert.





Holismus - Ganzheit als System der
Philosophie
Der Holismus bzw. die Ganzheitslehre nimmt an, dass die Elemente eines Systems – einer „Ganzheit“ – durch die Strukturbeziehungen nicht vollständig bestimmt sind; es ist die entgegengesetzte Position zum Reduktionismus (Materialismus, Mechanismus). Ganzheit in der Philosophie ist die auf die - Vielfalt angewandte - Einheit; und die Teile sind die Vielfalt selbst. Das Ganze, als etwas Gegliedertes und Zusammengefügtes, nennt man System. Das Gleichgewicht kann bei offenen Systemen (z.B. Unternehmen) auch durch ein so genanntes Fließgleichgewicht (dynamisches Gleichgewicht) hergestellt werden.
Kultureller Ansatz - Drei ewige Fragen
Die kulturellen Paradigma leiten sich nach Lipton und Bhaerman daraus ab, wie eine Gesellschaft die drei ewigen Fragen beantwortet: 1. Wie sind wir entstanden? 2. Wozu sind wir hier? 3. Wie können wir das Beste aus unserem Dasein machen? In westlichen Wirtschaftssystemen konkurrieren auf der kulturellen Ebene vor allem a) Materialismus und b) Holismus (Ganzheitlichkeit) miteinander. a) Altes Paradigma: Kartesianisch-newtonsche Sicht der Realität. b) Neues Paradigma: Die ganzheitliche Sicht der Realität als Verknüpfung von Geist und Materie.Wissenschaftlicher Ansätze - Paradigmen
1. Altes Paradigma: Charakteristisch für den kartesianisch- newtonschen Denkrahmen ist ein strikter Dualismus, der etwa Körper und Psyche, Materie und Geist undifferenziert gegenüberstellt (reduktionistisches Denken). 2. Neues Paradigma (die ganzheitliche Sicht der Realität). Insbesondere die Erkenntnisse der modernen Physik haben die Newtonschen Grundannahmen über die Materie, die Energie und das Objektivitätspostulat relativiert. Mit der Relativitätstheorie und Quantenmechanik wurden die Grundelemente der Newtonschen Physik in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt oder durch neue Erkenntnisse ausgeweitet.Emergenz - Das interdisziplinäre Konzept
Emergenz ist die Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen (Übersummativität). So wird von einigen Philosophen die Meinung vertreten, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns sei. Emergente Phänomene sind z..B. kollektive Intelligenz von Menschen und Schwarmintelligenz bei Wildenten.Radikaler Konstruktivismus -
Die Theorie des Wissens
Der Radikale Konstruktivismus wird als eine Theorie des Wissens verstanden. In den letzten Jahren haben sich die vom Radikalen Konstruktivismus ausgehenden Ideen über Selbsterzeugung, Selbstorganisation und Selbstreferenz als äußerst fruchtbar erwiesen. Auf dieser Grundlage haben z.B. Philosophen und Psychologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Biologen und Neurophysiologen, Juristen und Ethnologen, Psychotherapeuten und Kunstwissenschaftler sowie Soziologen und Ingenieure ihre Disziplinen erneuert und erweitert.
Weltbilder
Sichtweisen der Welt, d.h. grundlegende kognitive Konzepte
der materiellen, sozialen und transzendenten Wirklichkeit, die
als Überzeugungssystem sozial vermittelt, rezipiert und in
einer rekonstruktiven Leistung individuell angeeignet werden.
Dazu gehören
1.
Auffassungen über die Entstehung der Welt und des
Lebens (Kosmologie): Urknalltheorie, Evolutionstheorie
vs. naiver Schöpfungsglaube;
2.
Fragen nach Wesen und Struktur der Wirklichkeit
(Ontologie): Kausalitätsverständnis; kindliche
Auffassungen, alle Dinge seien lebendig und beseelt,
seien von irgendjemandem "gemacht" und dienten
immer einem Zweck (Animismus, Artifizialismus und
Finalismus) (Aberglaube, Parapsychologie);
3.
Wissenschaftsverständnis: Erkenntnis-Skeptizismus vs.
Wissenschaftsgläubigkeit ("Scientism");
4.
Fragen nach einer transzendenten Wirklichkeit
(Metaphysik): Gottesbild vs. Atheismus; Auffassungen
über Tod und Ewigkeit (Transpersonale Psychologie);
5.
Auffassungen über die Natur des Menschen
(Menschenbilder);
6.
Kohärente und konsistente Vorstellungen über die
gesellschaftliche Wirklichkeit (Gesellschaftsbilder), z.B.
Vorstellungen über soziale Verteilungs- und
Chancenungleichheiten und über deren Legitimität.
Weltbilder werden als Hintergrundbedingung für die
"angewandten" moralischen und religiösen Urteile aufgefasst.
Existentielle Erfahrungen können aber auch zunächst das
religiöse Urteil und – gleichsam rückwirkend – das Weltbild
verändern. Die Entwicklung verläuft von naiven,
egozentrischen, eindimensionalen zu realitätsorientierten,
komplexen und differenzierten Weltbildern. Quer zu den
verschiedenen Facetten von Weltbildern entwickelt sich die
Grundfähigkeit, scheinbar unvereinbare Aspekte oder
Erklärungsansätze gleichzeitig zu berücksichtigen und in einer
komplexeren Perspektive zu integrieren, beispielsweise
biblischen Schöpfungsglauben und naturwissenschaftliche
Betrachtung, Kausalität und Finalität ("Komplementarität"
nach Oser & Reich, 1986). Aufgabe der Erziehung ist es, diese
Entwicklung zu komplexem und komplementärem Denken zu
unterstützen.
Aus:
lexikon/psychologie/weltbilder
Ansätze , d.h. philosophisch - kulturelle und wissenschaftliche, können auf Einzeldisziplinen (z.B.
Philosophie, Natur- und Wirtschaftswissenschaften) und auf interdisziplinäre Theorien (mit Prinzipien
und Methoden, etc.) zurückgeführt werden.
Als Einzeldisziplin ist z.B. die Erkenntnistheorie (Erkenntnis
ist schöpferisch konstruiert) - als Teil der Philosophie - zu nennen; als interdisziplinär gelten insbesondere
die Systemtheorie (als Modell der Natur/des Denkens), Synthetische Evolutionstheorie (für natürliche
Entwicklungen des Lebens, d.h. Entstehung der Arten und ihre Adaption), Evolutionäre Erkenntnistheorie
(die reale Welt wird intern rekonstruiert) und der Radikale Konstruktivismus (als Theorie des Wissens). Durch
diese Ansätze werden Wertesysteme erzeugt.
Neben den evolutionären Theorien gibt es auch revolutionäre Theorien und Thesen, die bisher
allerdings keine interdisziplinäre Anerkennung fanden (z.B. die Revolutionstheorie von Marx, die
Revolutionstheorie für das 21. Jahrhundert); gleichwohl haben sich in Wirtschaft und Gesellschaft
(Politik) Interpretationen des Begriffes „Revolution“ und damit verknüpfte Prinzipien und Methoden
verbreitet, häufig im Kontext mit den Begriffen „Wandel“ und und „Evolution“, letztere auch als
konträre Gegenüberstellung.
Anmerkung zur Ökonomie: „Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft“
„In den mathematischen Naturwissenschaften liegt die Verbindung zwischen Mathematik und Realität
im Experiment, in dem die mathematischen Idealbedingungen im Labor erst hergestellt werden. Nur
dort tritt ein mathematisches Naturgesetz in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit überhaupt in
Erscheinung. Oder eben auch nicht, was dann zur Revision der zugrunde liegenden Theorie führt. Was
macht nun aber ein Fach wie die Ökonomie, in dem Experimente nicht möglich sind, sondern allenfalls
Beobachtungen? Hier fällt das mit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode verbundene
Wahrheitskriterium weg - doch was tritt dann an seine Stelle? Daraus ergeben sich schwierige
methodische Fragen. Was ich den mathematischen Ökonomen zum Vorwurf mache und mich an
ihrem Vorgehen wirklich stört, das ist, dass sie sich mit diesem Problem gar nicht erst
auseinandersetzen…“
Prof. Claus Peter Ortlieb, FB Mathematik der Uni Hamburg in einem Interview mit der FAZ, 08.05.2010
Kurzbeschreibung der Inhalte
Am Anfang war der Geist (Himmelshaken) „Die Materie – die nicht denkende Materie und Bewegung – kann niemals das
Denken erzeugen, gleichviel, welche Veränderungen von Gestalt und Größe sie auch hervorrufen mag. Die Erzeugung des
Wissens wird immer ebenso weit über das Vermögen der Bewegung und der Materie hinausgehen, wie die Erzeugung der
(Locke 1690: Über den menschlichen Verstand [nach Dennett[1995] 1997: Darwins gefährliches Erbe])